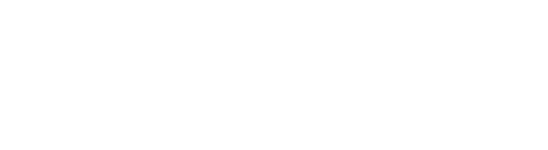Verlaatshus und Schleuse

Wiebke Tiedeken: Wie ihr bereits gehört habt, waren die Schleusen in den ostfriesischen Fehngebieten enorm wichtig. Die Kammerschleuse, vor der wir gerade stehen, ist ein Nachbau der ursprünglichen Schleuse, die bereits 1957 ausgebaut wurde, da man sie weder für die Schifffahrt noch für die Entwässerung des Hinterlandes benötigte. Die nach wie vor wichtige Entwässerung wird heute von einem Schöpfwerk übernommen.
Jule: Aber warum hat man dann 1994 überhaupt einen Nachbau angefertigt, der war doch bestimmt sehr teuer?
Wiebke Tiedeken: Das ist richtig, Jule. Der Nachbau dient zum einen als weitere touristische Attraktion und zum anderen den Freizeitkapitänen, die mit ihren Botten im Wendebecken vor Anker gehen können. An der heutigen Schleuse könnt ihr übrigens die unterschiedlichen Wasserstände diesseits und jenseits der Tore erkennen. Im Tagesverlauf ändert sich der Höhenunterschied, weil sich der Wechsel von Ebbe und Flut in der Nordsee mit einer zeitlichen Verzögerung bis zur Schleuse auswirkt. Der Bereich um die Schleuse galt lange Zeit nicht nur als beliebter Badeplatz, sondern war zudem sehr fischreich und es gibt Bilder, die belegen, dass hier vorher sogar Wasserball gespielt wurde.
Laura: Krass!
Jette: Irgendwie hat man das Gefühl, dass sich hier eine Menge um das Wasser dreht. Mir schwirrt schon der Kopf bei all den Kanälen, Wieken, Schleusen und Brücken.
Wiebke Tiedeken: Ihr wisst sicher, dass die Gemeinde Rhauderfehn 2019 250 Jahre alt geworden ist. Die Gründung verdankt Rhauderfehn fünf wagemutigen Männern, die sich von der Urbarmachung der Moore nicht nur ein gutes Geschäft, sondern auf absehbare Zeit auch die Gründung einer Fehnkolonie versprachen. Und ihr Konzept ging auf: Es wurden Stichkanäle gegraben, die zum einen die Moore entwässerten und das Land nutzbar machten, zum anderen wurde mit den Stichkanälen eine Verbindung zu den schiffbaren Wasserstraßen geschaffen. Während die ersten Fehntjer noch in bitterer Armut lebten, begann im 19. Jahrhundert der Handel mit Torf, die an die ostfriesische Küste per Tjalk transportiert wurde. Die Schiffe kamen dann mit Baustoffen und dem wichtigen Dünger für die kargen Moorböden zurück.
Maren: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich könnte jetzt gut eine Tasse Tee und Krintstuut vertragen.
Wiebke Tiedeken: Da müsst ihr euch noch eine Weile gedulden. Außerdem werden in Ostfriesland mindestens drei Tassen Tee mit Kluntje und Sahne getrunken. Aber wenn ihr einen Blick über die Schleusenkammer auf das Gebäude richtet, seht ihr dort das zum „Hotel-Verlaatshus“ umgebaute ehemalige Compagniehaus, das übrigens als das erste massiv aus Stein errichtete Haus in Westrhauderfehn galt. Indirekt profitierten die Fehntjer und Auswärtigen über viele Jahre davon, dass die Inhaber des Compagniehauses auch eine Landwirtschaft betrieben.
Hanna: Versteh ich nicht! Warum profitierten die Leute indirekt davon? Vermutlich haben sie doch direkt von den Erzeugnissen profitiert, indem sie diese gegessen haben.
Laura: Genau Hanna! Schnitzel mit Pommes rot-weiß! Oder möchtest du lieber einen Gemüseburger?
Wiebke Tiedeken: Eigentlich wollte ich einen anderen Sachverhalt ansprechen: Da sich die landwirtschaftlichen Flächen an das Hinterhaus anschlossen und bis an das Untenende heranreichten, wurde das Gebiet bis in die 50er Jahre nicht bebaut. Das bot Gelegenheit, hier zum Fehntjer Markt Fahrgeschäfte und Schaustellerbuden aufzustellen. Aber ich sollte nicht so viel vom Marktvergnügen und Essen und Trinken reden, sonst schaffen wir die restlichen Stationen nicht.