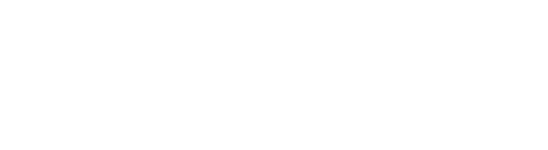Kreisel / 3-Brücken

Wiebke Tiedeken: Okay, meine Damen, wenn ihr nun in Richtung Rhauderwieke blickt, das ist dort, wo sich die Anker-Apotheke befindet, werdet ihr es kaum für möglich halten, dass es dort einmal eine Wieke gegeben hat, die in den Hauptfehnkanal mündete.
Hanna: Ich finde es total schade, dass man dort alles zubetoniert hat. Fehnbild geht anders.
Jule: Finde ich auch. (kurze Pause) Mir ist aufgefallen, dass viele Ortschaften hier ein „Fehn“ im Namen tragen. Was bedeutet „Fehn“ eigentlich?
Hanna: Ich habe mal gelesen, das „Fehn“ soviel wie „Moor“ bedeutet.
Wiebke Tiedeken: Das ist richtig, Hanna. Der Name „Fehn“ ist vom niederländischen “Veen“, mit V und doppeltem e, abgeleitet. Vielleicht kennt ihr den niederländischen Liedermacher Hermann van Veen. (Singt): „He, kleiner Fratz, auf dem Kinderrad!“
Birthe: Wer soll das denn sein, ich stehe mehr auf David Guetta.
Laura: Den hört niemand mehr. Richtig gute Musik machen heute nur noch…
Wiebke Tiedeken: Ich möchte lieber noch einmal auf dein Frage zurückkommen, Jule. Orte mit der Endung „Fehn“ deuten auf eine genau festgelegte Kultivierungsmethode hin, nach der die Hochmoore seit dem 17. Jahrhundert zur Brenntorfgewinnung erschlossen und anschließend urbar gemacht wurden. Daher legten die Moorkolonisten im Laufe von Jahrzehnten ein Netz von Wasserwegen an, durch das sie mit ihren Plattbodenschiffen bis tief in das Moor vordringen konnten. Entlang vieler dieser Wasserwege wurden Pfade und Wege angelegt. Auch musste ja eine Querung über das Wasser möglich sein. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass dies ganz schön aufwendig gewesen ist. Dort, zum Beispiel, wo der Kanal im Untenende, die Rajenwieke, die 1. Südwieke und die Rhauderwieke aufeinandertrafen, waren drei Klappbrücken erforderlich, um die Überquerung der Wasserwege in alle Richtungen zu ermöglichen.
Birthe: Und heute baut man einfach einen großen Kreisel, nicht schön aber zweckmäßig. Schiffbar sind die verbliebenen Wieken aber zum großen Teil nicht mehr.
Wiebke Tiedeken: Stimmt. Interessant ist übrigens noch Folgendes. Da ohne die Plattbodenschiffe eine Versorgung der Fehntjer bis in die 1930er Jahre nicht ausreichend möglich gewesen wäre, mussten die Klappbrücken so montiert werden, dass die Schiffe auch bei Windflaute von Menschen oder Pferden gezogen werden konnten. Das nennt man „Treideln“. Dafür mussten bei geöffneten Klappbrücken ein durchgängiger Treidelpfad entstehen.