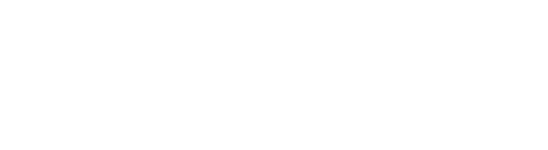Rhauderwieke

Wiebke Tiedeken: Wir sind jetzt an der Station 13, der Rhauderwieke, angekommen. Die Rhauderwieke ist die Straße im Zentrum der heutigen Gemeinde Rhauderfehn, die ihr Gesicht seit der Gründung des „Rhauder Fehns am deutlichsten verändert hat. Kaum zu glauben, aber auf der heute so belebten Straße bot früher ein Kanal Gelegenheit, mit dem Schiff bis zum Ziegeleiring zu fahren.
Hanna: Ich finde es total schade, dass man hier alles zubetoniert hat. Wenn ich darüber nachdenke, welche touristischen Möglichkeiten heute ein Kanal geboten hätte, glaube ich, dass die Menschen damals einen Fehler gemacht haben.
Wiebke Tiedeken: Ich persönliche stimme dir mit ganzem Herzen zu. Allerdings muss man den Planern zugutehalten, dass damals andere Prioritäten eine Rolle spielten und es immer leicht ist, aus heutiger Sicht Dinge zu kritisieren, die für die Menschen damals wohlmöglich einen Fortschritt bedeutet haben. Mit dem Aushub der „Rhauderwieke“ wurde übrigens bereits im Jahr 1785 begonnen, nachdem der Kanal am Untenende fertig gestellt war.
Laura: Wer hat den Aushub der Rhauderwieke in Auftrag gegeben, das muss doch aufwendig und teuer gewesen sein?
Wiebke Tiedeken: Dahinter verbirgt sich eine interessante Geschichte, Laura. Eigentlich war der Kanal von der „Fehn Compagnie“ gar nicht gewollt, doch die „Commune Rhaude“ bestand auf einen Kanal. Als Gegenleistung gab die „Commune Rhaude“ Land ab, das für den Bau des Hauptfehnkanals unerlässlich war. Ohne den Deal wäre der Hauptfehnkanal nie ausgehoben worden.
Hanna: Wenn ich das Wort „Deal“ höre, muss ich sofort an Donald Trump denken. Zum Glück lebte der damals noch nicht, sonst würde hier bestimmt irgendwo eine Mauer stehen.
Wiebke Tiedeken: Keine Angst, Hanna, die Ostfriesen gelten als gastfreundlich und tolerant!
Jule: Stimmt, selbst Birthe mit ihrem Schuhtick haben sie ins Land gelassen.
Birte: Wozu benötigte die „Commune Rhaude“ überhaupt den Kanal?
Wiebke Tiedeken: Mit Hilfe des Kanals sollte Rhaudermoor in Eigenregie kultiviert und ein direkter Zugang zu einer Ziegelei geschaffen werden.
Laura: Was musste man denn da kultivieren?
Hanna: Ist doch klar, ich habe gelesen, dass sich unter dem Moor eine 35 Meter mächtige Tonschicht befand. Ton bietet eine Grundvoraussetzung für die Ziegelherstellung. Und dann ist es nur folgerichtig, in der Nähe eine Ziegelei zu errichten und diese mit einer Wasserstraße zu verbinden.
Laura: War ja klar, dass du das wieder wusstest, aber welcher normale Mensch liest freiwillig Bücher über Rhauderfehn und bereitet sich schon im Vorfeld auf eine Führung vor?
Hanna (ironisch): Auch den Möbelpackern sind Leute, die Bücher lesen, zuwider. Aber sie haben wenigstens einen guten Grund dafür.
Laura: Blöde Ziege!
Maren: Mir fällt dazu noch folgendes Zitat ein: „Der Umgang mit Büchern bringt die Leute um den Verstand!“
Jule: Außerdem kommt Bildung von Bildschirm und nicht von Buch, sonst hieße es ja Buchung.
Wiebke Tiedeken: Nur keinen ein Stress, meine Damen, aber Hanna hat vollkommen Recht. Wegen der guten Voraussetzungen wurden von der Rhauderwieke neben der Verbindung zur Ziegelei die Jürgenas- und die Vereinswieke abgezweigt, um das Land urbar zu machen, Torf abzubauen und den Ton für die Ziegelherstellung zu gewinnen. Es gab übrigens noch eine zweite Ziegelei. Sie entstand am heutigen „Königskiel“.
Birte: Echt krass. Und wie ging es dann damit weiter?
Wiebke Tiedeken: An der Rhauderwieke wurden Geschäftshäuser errichtet. Dabei wurde auch der „Neue Weg“ bis hin zur Rhauderwieke verlängert. In der Nähe des Combi-Marktes gab es früher ebenfalls eine Werft. Dort wurden vor allem Muttschiffe und dann bis um 1920 Yachten sowie Boote gebaut und repariert. Nach dem Tod des Werftinhabers Johann Schlömer im Jahr 1928 ist dort nicht mehr gearbeitet worden.
Birte: Alles schön und gut. Ich möchte aber auch noch etwas über die Menschen erfahren, die hier gewohnt haben.
Wiebke Tiedeken: Natürlich! Interessant ist in diesem Zusammenhang z.B. die Lebensgeschichte des Viehhändlers Mozes Cohen. Als der Rat in den 1930er Jahren beschloss, den „Neuen Weg“ bis zur Rhauderwieke zu verlängern, stand diesem Vorhaben ein Haus im Wege - das des Viehhändlers Mozes Cohen. Es wurde kurzerhand abgerissen.
Birthe: Spannend. Ich liebe Tratschgeschichten, auch wenn sie schon beinahe 100 Jahre alt sind. Erzähl weiter!
Wiebke Tiedeken: Das bekannteste Haus befand sich auf der Ostseite des Kanals. Dort lebte der Arzt Dr. Walter Trepte. Man sagt ihm nach, dass er einer jungen Patientin in ihrem eigenen Haus den Kopf operiert hat. Sein Haus hatte der Arzt von dem Bauunternehmer Hayo Kluin erworben. Der Bauunternehmer wiederum besaß sein Geschäft am Untenende.
Maren: Mich interessiert die Geschichte von Dr. Trepte. Was wurde aus ihm?
Wiebke Tiedeken: Er führte seine Praxis weiter, bis er 1930 verstarb. Erwähnenswert ist zudem, dass der Arzt als erster ein Auto fahren durfte, das im Kreis Leer für die Nutzung auf öffentlichen Verkehrswegen zugelassen wurde.
Birthe: Krass!
Laura: Gab es denn auch so etwas wie einen zentralen Platz, wo man sich mit seinen Freunden treffen konnte, ein Café oder etwas Ähnliches?
Wiebke Tiedeken: Ja klar, die Menschen trafen sich immer wieder gerne in der Gaststätte „Deutsches Haus“, welches der Familie Plümer gehörte. Hinter der Gaststätte befand sich ein Stall, in dem der Wirt Arbeitspferde hielt, deren Aufgabe es unter anderem war, den Leichenwagen zu ziehen, wenn eine Beerdigung anstand.
Laura 2: Musste er nur die Verstorbenen auf dem Fehn transportieren oder kam es auch zu längeren Fahrten?
Wiebke Tiedeken: Es war damals üblich, die Verstorbenen im Haus aufzubahren und auch dort den sogenannten „Leichenschmaus“ einzunehmen. Somit musste Plümer zuweilen längere Strecken mit seinem Gespann zurücklegen. Aus den Erinnerungen von Willi Plümer wissen wir, dass er den Leichenwagen bis nach Burlage lenken musste, um Verstorbene abzuholen.
Birte: Uhhh, das ist schon gruselig, stell dir vor, du allein im Dunkeln mit einer Leiche…
Laura: Hör auf! Ich bekomme schon beim Zuhören eine Gänsehaut und kann heute Nacht bestimmt nicht schlafen….
Birthe: Angsthasen - aber sag einmal Wiebke, gab es hier denn nicht auch irgendwas mit Fashion?
Jule: Mensch Birthe…dreht sich in deinem Leben eigentlich alles nur um Mode? Das hier ist doch auch ganz spannend.
Wiebke Tiedeken: Ob du es glaubst oder nicht, Birthe, es gab damals tatsächlich ein Bekleidungsgeschäft direkt neben der Gaststätte, welches im Laufe der Jahrzehnte von unterschiedlichen Besitzern geführt wurde. Jedoch wurde das Geschäft bald in das Untenende verlegt, weil man sich dort einen größeren wirtschaftlichen Erfolg versprach.
Hanna: War der Standort Untenende denn wirklich besser?
Wiebke Tiedeken: Augenscheinlich schon, zumindest lässt sich dies für das Bekleidungsgeschäft Aden nachweisen. Herr Aden verlagerte sein Geschäft bereits 1906 aus diesem Gebäude in das Haus neben der Schule im Untenende. Auch Johann Pieper zog mit seinem Geschäft später zum Untenende, wo er seine Waren im Laufe der Zeit in verschiedenen Ladengeschäften anbot.
Birte: Aber wenn alle zum Untenende gingen, was geschah dann mit dem Geschäftshaus?
Wiebke Tiedeken: Das letzte Kapitel dieses Hauses wurde 1955 aufgeschlagen, als der Bierverlag Peters seinen Standort vom Untenende hierher verlegte.
Laura: Das verstehe ich nicht? Ich dachte, alle wollten zum lukrativen Untenende, warum kommt Peters zurück?
Wiebke Tiedeken: Ganz freiwillig ist er möglicherweise nicht zurückgekommen. Aber die auf 20 Jahre festgelegte Pachtzeit für das Haus Lücht, in dem er sein Unternehmen betrieb, war abgelaufen. Während Peters am Untenende einen Eiskeller besaß, indem das Eis bis in den Sommer gelagert wurde, das übrigens im Winter im Untenende oder in der Dosewieke geschlagen worden war, musste der Getränkehändler nun einen Kühlraum für industriell produziertes Eis, das er zum Kühlen benötigte, in der Rhauderwieke errichten.
Jule: Schade Birthe, dass der nicht mehr hier ist, er hätte dir bestimmt etwas Eis für deine Füße gegeben.
Birthe: Im Moment wäre mir ein leckeres italienisches Speiseeis lieber!