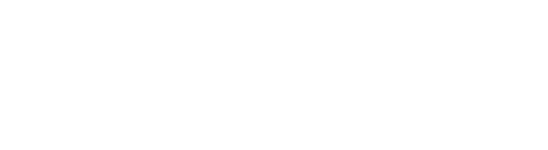Liegebecken mit Blick auf die Mühle

Wiebke Tiedeken: Hier sind wir nun bei Station 10, dem Liegebecken, angekommen. Wo heute die Boote der Freizeitkapitäne festmachen, herrschte bis in die 1930er Jahre reges wirtschaftliches Treiben. Die Verbindung zwischen dem Hauptfehnkanal und dem Kanal im Untenende war als Wendebecken ausgebaut, damit die Binnenschiffer ihre Mutten, Tjalken oder Poggen in Fahrtrichtung ausrichten konnten. Ihr könnt euch mittlerweile vorstellen, dass es wegen der Enge auf den Kanälen und Wieken sonst kaum Gelegenheit dazu gab.
Hanna: Tjalken, Mutten - ich dachte, das wären alles Plattbodenschiffe. Wenn du von der Schifffahrt in Westrhauderfehn erzählst, könnte man den Eindruck gewinnen, dass es hier von Schiffen wimmelte. Was sind denn die Hauptunterschiede zwischen einer Tjalk und einer Mutte?
Wiebke Tiedeken: Da die Siedler auf den Fehnen ein karges Auskommen hatten, suchten sie sich Nebentätigkeiten, u.a. in der Fehnschifffahrt. Es entstanden im 19. Jahrhundert, zur Blütezeit der Segelschiffe, viele kleine Schiffswerften in den Fehnorten. Hauptsächlich wurden Mutten, Poggen und Tjalken gebaut. Die Mutte, auch Torfmuttjes genannt, war das kleinste Schiff. Als charakteristisches Merkmal galt für die Mutten, dass sie schmal waren im Verhältnis zu ihrer Länge, einen flachen Boden und eine runde Kimm besaßen. Die ostfriesischen Schiffe zeichnen sich vor allem durch große Dauerhaftigkeit aus, da nur bestes Eichenholz verwendet wurde. Die Schiffe mussten in der Regel getreidelt werden. Die Enge der Kanäle ließ es nicht zu, dass die Schiffe im Wind kreuzten, somit konnte das Segel selten eingesetzt werden. In der Praxis sah das häufig so aus: Der Schiffseigner saß am Ruder und ein Schiffsjunge zog vom Ufer aus das Schiff.
Jule: (zu Birthe) Und du beschwerst dich über schmerzende Füße!
Wiebke Tiedeken: Das Liegebecken diente übrigens ebenfalls dazu, die Schiffsneubauten des Werftbesitzers Andreas Harms zu wassern. Allerdings nur bis zum Jahr 1925. Dann musste der Werftbetrieb wegen Auftragsmangel eingestellt werden.
Birte: Und was wurde aus dem Gelände?
Wiebke Tiedeken: Der Bauunternehmer Heye Prahm errichtete hier ein Wohn- und Geschäftshaus, indem seine Frau eine Parfümerie betrieb. Nach dem Krieg wurde das Haus an die Schlegelbrauerei verkauft. Heute dient das Anwesen der Steuerberatungsgesellschaft Kropacz & Waßerloos als Unterkunft. Davor, ich meine es muss Ende der 60er Jahre gewesen sein, war die Kult-Disco „Kajüte“ in den Räumlichkeiten untergebracht. In regelmäßigen Abständen finden immer noch „Kajüten-Revivals“ statt, natürlich nicht in diesem Gebäude. Interessant ist übrigens, dass auf der Schautafel die Mühle „Zeldenrüst“ abgebildet ist, mit der eine wechselvolle Geschichte verbunden ist. Ihre Geschichte steht stellvertretend für den großen wirtschaftlichen Erfolg, aber auch für großes Leid der Müllerfamilie. Wenn ich jedoch eure Reaktionen richtig interpretiere, verweise ich an dieser Stelle lieber auf die Broschüre „Vergangenheit neu erleben“, die ihr im Rathaus für kleines Geld erwerben könnt.
Laura 2: Gute Idee!